| 1 | 17.1 | Die Absolventin/der Absolvent erläutern als kritische Anwenderinnen/Anwender die Prinzipien und Methoden der Evidenzbasierten Medizin und Zahnmedizin und wenden diese bei Problemstellungen im Rahmen der Behandlung individueller Patientinnen/Patienten an.  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 2 | 17.1.1 | Sie nehmen eine Erhebung und kritische Bewertung von insbesondere primärer, aber auch sekundärer Evidenz zu einer medizinischen/zahnmedizinischen Fragestellung vor. Sie können …  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 17.1.1.1 | Problemstellungen in präzise wissenschaftliche Fragen übersetzen, die in Fach- /Literaturdatenbanken recherchierbar sind.  | 2 | 3a | | 3b | 3a | | | | | | | | Gen- und Proteindatenbanken; Medline, PubMed, Cochrane; Prävalenz | | |
| | | | | |
| 3 | 17.1.1.2 | eine Literaturrecherche nach der bestverfügbaren Evidenz für diese Problemstellungen durchführen.  | 2 | 3a | | 3b | 3a | | | | | | | | Medline, PubMed; Embase; Leitlinienregister; oder Cochrane | | |
| | | | | |
| 3 | 17.1.1.3 | die zu dieser Problemstellung gefundene Evidenz hinsichtlich ihrer Relevanz und Validität kritisch bewerten.  | 2 | 3a | | 3b | 3a | | | | | | | | Prätestwahrscheinlichkeit und prädiktiven Wert, Sensitivität und Spezifität, Randomisierung, Confounding, Verblindung, intention-to-treat, relatives Risiko, relative Risikoreduktion (absolut versus relativ), Selektionsbias, Publikationsbias, Signifikanz im Kontext erläutern und einsetzen | | |
| | | | | |
| 2 | 17.1.2 | Sie nutzen erhobene und kritisch bewertete insbesondere primäre, aber auch sekundäre Evidenz zur Entscheidungsfindung bei einer medizinischen/zahnmedizinischen Fragestellung im zahnärztlichen Alltag. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 17.1.2.1 | die gefundene und bewertete Evidenz den Patientinnen/Patienten in einer für diese verständlichen Form darstellen und in den Behandlungsablauf integrieren.  | | 3a | | 3b | | | | | | | | | "evidence of absence " und "absence of evidence" unterscheiden | | |
| | | | | |
| 3 | 17.1.2.2 | ihr eigenes wissenschaftlich-zahnärztliches Umgehen mit diesen Problemstellungen erläutern und bewerten.  | | 3a | | 3b | | | | | | | | | Bewertung des eigenen Kenntnisstandes hinsichtlich der wissenschaftlichen Basis | | |
| | | | | |
| 3 | 17.1.2.3 | die Methoden der zahnärztlich-klinischen Entscheidungsfindung anwenden.  | | 3a | | 3b | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 17.1.2.4 | die Validitätskriterien und den klinischen Nutzen von Leitlinien erläutern und diese im Alltag anwenden.  | | 3a | | 3b | | | | | | | | | Leitlinienstufen (S1-S3), AWMF-Portal | | |
| | | | | |
| 1 | 17.2 | Die Absolventin/der Absolvent leisten einen Beitrag zum Entstehen neuer Erkenntnisse.  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 2 | 17.2.1 | Sie leiten eine Forschungsfrage ab, formulieren sie aus und generieren davon ausgehend wissenschaftliche Hypothesen. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | im Rahmen einer Studienarbeit, Promotionsvorbereitung | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.1.1 | unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Hypothesengenerierung erläutern.  | 1 | | | | 3a | | | | | | | | Induktiv, deduktiv, empiristisch, rationalistisch | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.1.2 | unterschiedliche Hypothesenformen erklären.  | 1 | | | | 3a | | | | | | | | bei klinischen Studien Vergleich mit Placebo, Vergleich mit Goldstandard, verschobene Nullhypothesen bei Äquivalenz- und Nicht- Unterlegenheitsstudien | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.1.3 | eine Problemstellung in eine präzise, überprüfbare wissenschaftliche Fragestellung übersetzen.  | 1 | | | | 3a | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.1.4 | den bisherigen Kenntnisstand zu einer Fragestellung recherchieren, kritisch rezipieren und zusammenfassend darstellen.  | 1 | | | | 3a | | | | | | | | Originalarbeiten, Übersichtsarbeiten, Metaanalysen, Phasenkonzept klinischer Studien | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.1.5 | Fragestellungen und davon ausgehend testbare Hypothesen unter Berücksichtigung des bisherigen Kenntnisstands herleiten.  | | | | | 3a | | | | | | | | deskriptive, explorative, explanative Fragestellungen | | |
| | | | | |
| 2 | 17.2.2 | Sie können eine wissenschaftliche Untersuchung planen und durchführen. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | im Rahmen einer Studienarbeit, Promotionsvorbereitung | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.1 | die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen wissenschaftlichen Arbeitens erklären und anwenden.  | | | | | 3a | | | | | | | | Ethikkonvention von Helsinki, Tierschutzrichtlinien, Datenschutz, Datensicherheit | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.2 | die Richtlinien guter wissenschaftlicher Praxis und guter klinischer Praxis erklären und anwenden.  | | | | | 3a | | | | | | | | DFG-Richtlinien, Good Clinical Practice Kriterien, Gute epidemiologische Praxis (GEP), Deklaration von Helsinki | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.3 | die Rahmenbedingungen für unterschiedliche Studienarten erklären.  | | | | | 3a | | | | | | | | DFG-Definition klinischer Forschung: grundlagenorientierte, krankheitsorientierte und patientenorientierte Forschung (umfasst Versorgungsforschung, DFG 1999, S. 3) | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.4 | die eigene Spezialisierung/Limitierung wahrnehmen und bei Bedarf weitere Expertisen einholen.  | | | | | 3a | | | | | | | | statistische Planung; Labormethoden; Fragebogenmethoden | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.5 | mögliche Untersuchungs-"Objekte" benennen und deren Auswahl wissenschaftlich herleiten und begründen.  | 1 | | | | 3a | | | | | | | | in der klinischen Forschung Patienten und Probanden unterscheiden, in der biowissenschaftlichen Forschung den Einsatz von Tierversuchen oder Zellkulturen begründen | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.6 | mögliche Untersuchungsmethode benennen und deren Auswahl wissenschaftlich herleiten und begründen.  | 1 | | | | 3a | | | | | | | | Zellkultur, biochemische, werkstoffkundliche, anatomische oder physiologische Methoden, Fallbericht, randomisierte klinische Studie, Fragebogen und Interviews | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.7 | Untersuchungsvariablen operationalisieren und die gewählte Operationalisierung wissenschaftlich herleiten und begründen.  | 1 | | | | 3a | | | | | | | | Testgütekriterien, quantitative und qualitative Zielkriterien, Ereigniszeiten, Surrogatkriterien, Primäre/sekundäre Endpunkte | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.8 | Stichprobentechniken erklären, anwenden und ihre Auswahl wissenschaftlich herleiten und begründen.  | | | | | 3a | | | | | | | | Aussagekraft probabilistischer versus nicht-probabilistischer Techniken | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.9 | Versuchspläne erklären, anwenden und ihre Auswahl wissenschaftlich herleiten und begründen.  | 1 | | | | 3a | | | | | | | | Labor versus Felduntersuchung; randomisierte kontrollierte Studie versus Kohortenstudie, Prognose- und Risikostudien, Äquivalenz- und Nicht- Unterlegenheitsstudien | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.10 | Techniken zur Biaskontrolle erklären, anwenden und wissenschaftlich herleiten und begründen.  | | | | | 3a | | | | | | | | Randomisierung, Matching, Konstanthalten, Ausschalten, Verblindung, Ausbalancieren, Gegenbalancieren | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.11 | die Notwendigkeit einer Fallzahlschätzung begründen und die Voraussetzung einer Fallzahlschätzung benennen.  | | | | | 3a | | | | | | | | erwartete Effektstärken, Verfahren zur Effektstärkenmaximierung, klinische Bedeutung unterschiedlicher Effektstärken, minimaler klinisch relevanter Unterschied | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.12 | eine Messung durchführen und dokumentieren.  | 1 | | | | 3a | | | | | | | | strukturierte personenbezogene Dokumentation, Laborbuch | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.2.13 | die Grundzüge des Projektmanagements auf ihre Untersuchung anwenden.  | | | | | 3a | | | | | | | | Zeitplanung, Probandenakquise, Datenerhebung, Datenverarbeitung, Dokumentation | | |
| | | | | |
| 2 | 17.2.3 | Sie wenden sachgerecht statistische Methoden zur Hypothesenüberprüfung an. Sie können …  | | | | | | | | | | | | | im Rahmen einer Studienarbeit, Promotionsvorbereitung | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.3.1 | aus Forschungshypothesen statistische Hypothesen ableiten.  | | | | | 3a | | | | | | | | statistisches Hypothesenpaar | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.3.2 | geeignete Verfahren zur Prüfung der statistischen Hypothesen anwenden, wissenschaftlich herleiten und begründen, bzw. ihren statistischen Beratungsbedarf erkennen und eine Beratung durch eine Biometrikerin oder einen Biometriker qualifiziert vorbereiten.  | | | | | 3a | | | | | | | | Tests für unabhängige und abhängige Daten, parametrische und nicht-parametrische Methoden, einfaktorielle versus mehrfaktorielle Analysen | | |
| | | | | |
| 3 | 17.2.3.3 | Entscheidungsfehler bei der statistischen Hypothesenprüfung erklären und Methoden wissenschaftlich herleiten, begründen und anwenden, um diese zu minimieren.  | | | | | 3a | | | | | | | | Effektstärkenmaximierung via Standardisierung, Vergrößerung der Stichprobe, Probleme des multiplen Testens, adaptive Designs | | |
| | | | | |
| 1 | 17.3 | Die Absolventin/der Absolvent leisten einen Beitrag zur Verbreitung, Anwendung und Translation neuer Erkenntnisse und Praktiken.  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 2 | 17.3.1 | Sie präsentieren und diskutieren die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung. Sie können …  | | | | | | | | | | | | | im Rahmen einer Studienarbeit, Promotionsvorbereitung | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.1.1 | verschiedene Methoden der textlichen, grafischen und tabellarischen Ergebnisdarstellung anwenden.  | | | | | 3a | | | | | | | | Blockdiagramm; Scatter-Plot, Forest-Plot, Box-Plots | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.1.2 | das Ergebnis einer statistischen Hypothesenprüfung interpretieren und präsentieren.  | | | | | 3a | | | | | | | | absence of evidence versus evidence of absence, Prinzip der Falsifikation | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.1.3 | die Aussagekraft einer wissenschaftlichen Untersuchung hinsichtlich methodischer Gesichtspunkte kritisch diskutieren.  | | | | | 3a | | | | | | | | Variablenvalidität; Generalisierbarkeit, interne, externe und statistische Validität | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.1.4 | Ergebnisse einer Untersuchung im Kontext vorhandener Erkenntnisse kritisch diskutieren.  | | | | | 3a | | | | | | | | Widersprüche, methodische Differenzen | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.1.5 | den durch eine Untersuchung erreichten Erkenntnisgewinn darstellen und kritisch im Hinblick auf zukünftigen Forschungsbedarf diskutieren.  | | | | | 3a | | | | | | | | Forschungsausblick | | |
| | | | | |
| 2 | 17.3.2 | Sie machen die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung der medizinischen/zahnmedizinischen Praxis zugänglich. Sie können …  | | | | | | | | | | | | | im Rahmen einer Studienarbeit, Promotionsvorbereitung | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.2.1 | Konflikte zwischen den Rollen als zahnärztlich und als wissenschaftlich handelnde Person reflektieren.  | | | | | 3a | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.2.2 | für die Medizin und Zahnmedizin bedeutsame Begriffe und Konzepte verschiedener Fachwissenschaften auf differenzierte und den wissenschaftlichen Standards angemessene Weise verwenden.  | | | | | 3a | | | | | | | | Kultur- und Sozialwissenschaften: "Kultur", "Migrationshintergrund" | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.2.3 | wissenschaftliche Ergebnisse für ein Fachpublikum nach den Regeln wissenschaftlicher Publikationen aufbereiten.  | | | | | 3a | | | | | | | | Autorenrichtlinien | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.2.4 | wissenschaftliche Ergebnisse für ein Fachpublikum mündlich präsentieren.  | | | | | 3a | | | | | | | | Poster, wissenschaftlicher Vortrag | | |
| | | | | |
| 3 | 17.3.2.5 | wissenschaftliche Ergebnisse in einer für Laien verständlichen Form darstellen.  | | | | | 3a | | | | | | | | Patientenberatung, Populärwissenschaftliches Material, Risikokommunikation, Kommunikation statistischer Ergebnisse in einer für Laien nachvollziehbaren Form | | |
| | | | | |

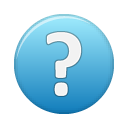 Hilfe
Hilfe
 Mit Klick auf die Lupe wird das entsprechende Lernziel vermerkt. Alle vermerkten Lernziele können über den Link "Gemerkte Lernziele -> Anzeigen" im Kopf der Tabelle angezeigt und verglichen werden.
Mit Klick auf die Lupe wird das entsprechende Lernziel vermerkt. Alle vermerkten Lernziele können über den Link "Gemerkte Lernziele -> Anzeigen" im Kopf der Tabelle angezeigt und verglichen werden.