| 1 | 18.1 | Die Absolventin/der Absolvent kennen die Grundlagen von Ethik, Recht und Berufskunde und ihre historische und soziokulturelle Entwicklung und können diese erläutern und anwenden.  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 2 | 18.1.1 | Sie kennen den Einfluss historischer und soziokultureller Aspekte und Bedingtheiten auf den zahnärztlichen Beruf und können diese erläutern. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.1.1 | die historische, kulturelle und gesellschaftliche Bedingtheit und Veränderlichkeit der Grundlagen der Berufsausübung, der relevanten medizinethischen Normen und Werte und der rechtlichen Vorgaben erklären.  | | | | 2 | | | | | | | | | Tätigkeit als Laienbehandlerinnen/ -behandler oder ohne standardisierte Ausbildung, handwerklich ausgebildete Dentistinnen/Dentisten, akademische Zahnärztinnen/Zahnärzte | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.1.2 | die wesentlichen Entwicklungsschritte des zahnärztlichen Berufs auf dem Weg zu einer modernen Profession sowie deren soziokulturelle Bedingtheiten und Kennzeichen erläutern.  | | | | 2 | | | | | | | | | Akademisierung, Erlangung beruflicher Autonomie (Freiberuflichkeit), berufliche Vorrang- oder Monopolstellung, hohes Sozialprestige | | |
| | | | | |
| 2 | 18.1.2 | Sie kennen die ethischen Grundlagen und Grundprinzipien und können diese erläutern. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.2.1 | die zentralen ethischen Grundbegriffe benennen und sie gegeneinander abgrenzen und die Aufgaben der Ethik erläutern.  | | | | 2 | | | | | | | | | die Begriffe Moral, Ethik, Berufsethos und berufliche Etikette, ethischer Konflikt, ethisches Dilemma | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.2.2 | unterschiedliche Ebenen ethischer Entscheidungsfindung differenzieren.  | | | | 2 | | | | | | | | | Gesellschaft, Gesundheitseinrichtung, Berufsgruppe, Arbeitsbereiche, Einzelfall | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.2.3 | ethische Grundprinzipien zahnärztlichen Handelns differenzieren.  | | | | 2 | | | | | | | | | Autonomie, Wohltun/Fürsorge, Nichtschaden, Gerechtigkeit | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.2.4 | unterschiedliche ethische Theorien und Argumentationstypen differenzieren.  | | | | 2 | | | | | | | | | Pflichtenethik, Tugendethik, Teleologische Ethik, Prinzipienethik | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.2.5 | die Genese und Rezeptionsgeschichte relevanter Kodizes und Berufsordnungen einordnen.  | | | | 1 | | | | | | | | | Hippokratischer Eid, Genfer Gelöbnis, Musterberufsordnung, Code of Ethics for Dentists in the European Union des CED, International Principles of Ethics for the Dental Profession der FDI | | |
| | | | | |
| 2 | 18.1.3 | Sie können die Rahmenbedingungen und (berufs)rechtlichen Grundlagen der zahnärztlichen Berufsausübung erläutern. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.3.1 | die gesetzlichen Rahmenbedingungen und (berufs)rechtlichen Grundlagen der zahnärztlichen Berufsausübung anwenden.  | | | | 3b | | | | | | | | | Zahnheilkundegesetz, Heilberufegesetze, Recht des Behandlungsvertrages/Patientenrechtegesetz | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.3.2 | die Grundlagen der zahnärztlichen Berufsausübung im nationalen und europäischen Kontext erklären.  | | | | 2 | | | | | | | | | Status einer Profession, Formen der Berufsausübung, Freiberuflichkeit, Strukturen und Aufgaben der Selbstverwaltung, Gestaltung der Fort- und der Weiterbildung | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.3.3 | die rechtlichen Vorgaben bei der Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeit berücksichtigen.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Rö-Verordnung, RKI-Richtlinien, BEMA, GOZ | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.3.4 | die berufsrechtlichen und -kundlichen Grundlagen der vertrags- und privatzahnärztlichen Versorgung erklären.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | GKV (SGB V Bundesmantelvertrag), PKV | | |
| | | | | |
| 3 | 18.1.3.5 | die gesetzlichen Grundlagen der Schweigepflicht und Entbindung von der Schweigepflicht anwenden und können die gebotenen Handlungsoptionen rechtlich und ethisch einordnen.  | | 1 | | 3b | | | | | | | | | Schweigepflichtentbindung zugunsten eines höherwertigen Rechtes, Zeuge in Zivil- und Strafprozessen | | |
| | | | | |
| 1 | 18.2 | Die Absolventin/der Absolvent verfügen über grundlegende ethische Fähigkeiten und Fertigkeiten und können diese einsetzen. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.2.1.1 | die eigene moralische Position reflektieren, weiterentwickeln und argumentativ vertreten.  | | 1 | | 3b | | | | | | | | | Selbstreflexion, Introspektion | | |
| | | | | |
| 3 | 18.2.1.2 | die moralischen und rechtlichen Dimensionen zahnärztlichen Handelns reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | patientenbezogen: Fürsorgepflicht, Schweigepflicht, Aufklärungspflicht, gesellschaftlich: Versorgungsauftrag, Gesundheitsaufklärung | | |
| | | | | |
| 3 | 18.2.1.3 | beim zahnärztlichen Handeln sensibel und verantwortungsbewusst mit Informationen, Daten, Patientinnen/Patienten sowie anderen Beteiligten umgehen.  | | 2 | | 3b | | | | | | | | | Umgang mit patientenbezogenen Daten, anderen Sichtweisen Beteiligter, Entscheidungsfindung | | |
| | | | | |
| 3 | 18.2.1.4 | von einem ethischen Konflikt betroffene Personen identifizieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.2.1.5 | ethische Grundprinzipien zahnärztlichen Handelns zur Bearbeitung konkreter ethischer Problemstellungen anwenden und (getroffene) medizinische Entscheidungen ethisch begründen.  | | 1 | | 3b | | | | | | | | | Urteilsfähigkeit und Diskursfähigkeit | | |
| | | | | |
| 3 | 18.2.1.6 | unterschiedliche ethische Argumentationstypen erkennen, gewichten und anwenden.  | | 1 | | 3a | | | | | | | | | deontologisch, teleologisch | | |
| | | | | |
| 3 | 18.2.1.7 | konstruktiv mit Vertretern unterschiedlicher ethischer Positionen kommunizieren und im Konfliktfall zur Vermittlung zwischen unterschiedlichen ethischen Positionen beitragen.  | | 1 | | 3b | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 1 | 18.3 | Die Absolventin/der Absolvent können die historischen, ethischen und rechtlichen Grundlagen für die Patientenversorgung erläutern und berücksichtigen. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.3.1.1 | die (individuelle und interindividuelle) Variabilität des Patientenstatus und der Patientenversorgung erläutern.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Einflussfakturen des Patientenstatus: Versichertenstatus, bestehende soziale Vulnerabilität, Einwilligungsfähigkeit; Einflussfaktoren der Patientenversorgung: historischer und soziokultureller Kontext | | |
| | | | | |
| 3 | 18.3.1.2 | die Voraussetzungen der informierten Einwilligung erklären.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Einwilligungsfähigkeit, Freiwilligkeit, vollständige Aufklärung (inklusive Risikoaufklärung), Verständnis der Informationen, Dokumentationsverpflichtung, Empfehlung einer Handlungsoption, Zustimmung der Patientinnen/Patienten | | |
| | | | | |
| 3 | 18.3.1.3 | die ethischen und rechtlichen Grundlagen von Aufklärung und Einwilligung bei Minderjährigen und Betreuten erklären.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Einsichtsfähigkeit, Einwilligungsfähigkeit, Entscheidungsfreiheit, Sorgeberechtigte | | |
| | | | | |
| 3 | 18.3.1.4 | den Begriff „Vulnerabilität“ erklären, vulnerable Patienten(gruppen) identifizieren und mit diesen bedarfsgerecht umgehen (vgl. auch 4.7).  | | 1 | | 3b | | | | | | | | | Minderjährige, Menschen mit geistiger Behinderung, demenzkranke Personen, Gefängnisinsassen, Angehörige der Streitkräfte, Patientinnen/Patienten ohne Aufenthaltserlaubnis und/oder Versicherungsschutz | | |
| | | | | |
| 3 | 18.3.1.5 | die Praxis der rechtlichen Vertretung von Patientinnen/Patienten und ihre normativen Implikationen berücksichtigen.  | | 1 | | 3b | | | | | | | | | Bevollmächtigung (Vorsorgevollmacht) und Betreuung (Betreuungsverfügung), mobile Zahnheilkunde, aufsuchende Zahnmedizin | | |
| | | | | |
| 3 | 18.3.1.6 | unterschiedliche Modelle der Beziehung von Zahnärztinnen/Zahnärzten und Patientinnen/Patienten benennen sowie deren historische und soziokulturelle Bedingtheit und Variabilität erläutern.  | | | | 2 | | | | | | | | | Paternalistisches oder Hippokratisches Modell, Partnerschaftliches oder Interaktives Modell, Vertragsmodell oder kommerzielles Modell | | |
| | | | | |
| 3 | 18.3.1.7 | die zentralen Aspekte des Behandlungsvertrags benennen und die hieraus resultierenden wechselseitigen Rechte und Pflichten von Zahnärztinnen/Zahnärzten und Patientinnen/Patienten erklären.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Dienstvertrag versus Werkvertrag | | |
| | | | | |
| 3 | 18.3.1.8 | Angehörige und andere Patientinnen/Patienten nahestehende Personen im Bedarfsfall und in angemessener Weise in die Behandlungsentscheidungen einbeziehen.  | | 2 | | 3b | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.3.1.9 | im interdisziplinären und interprofessionellen Team kooperieren und Teammitglieder unter Beachtung der Eigenverantwortung und der Delegationsgrundsätze in angemessener Weise in die Behandlungsentscheidungen einbeziehen.  | | 2 | | 3b | | | | | | | | | Delegationsrahmen der BZÄK | | |
| | | | | |
| 1 | 18.4 | Die Absolventin/der Absolvent kennen die historischen, ethischen und rechtlichen Grundlagen (in) der medizinischen Forschung und können diese erläutern. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.4.1.1 | historische Beispiele zahnmedizinischen und medizinischen Fehlverhaltens in der Forschung ethisch reflektieren.  | | | | 2 | | | | | | | | | Ärztliche Menschenversuche im "Dritten Reich", Vipeholm-Studie (Kariologie) | | |
| | | | | |
| 3 | 18.4.1.2 | die historischen und normativen Hintergründe der Regulierung der Forschung am Menschen in Deutschland und international wiedergeben.  | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.4.1.3 | die unterschiedlichen Zielsetzungen und Anforderungen zahnärztlicher Behandlung und klinischer Forschung differenzieren.  | | 1 | | 1 | | | | | | | | | Verpflichtung auf das individuelle Patientenwohl versus Sicherung des medizinischen Fortschritts | | |
| | | | | |
| 3 | 18.4.1.4 | die verschiedenen Formen der Forschung benennen, historisch und rechtlich einordnen sowie diese und die ethischen Grundkonflikte der Forschung am Menschen ethisch reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | potenziell eigennützige, gruppennützige und rein fremdnützige Forschung; Wohlergehen des Individuums versus Wohlergehen der Population, Arztrolle versus Forscherrolle | | |
| | | | | |
| 3 | 18.4.1.5 | die wesentlichen normativen Vorgaben für die Forschung am Menschen erläutern.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Deklaration von Helsinki, Arzneimittelgesetz, Medizinproduktegesetz, europäische Vorgaben | | |
| | | | | |
| 3 | 18.4.1.6 | die ethische und rechtliche Problematik der Forschung mit vulnerablen Versuchspersonen und Bevölkerungsgruppen in Deutschland und global erläutern.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | minderjährige, eingeschränkt oder nicht einwilligungsfähige Versuchspersonen sowie Angehörige sozialer und/oder ethnischer Minderheiten, medizinische Forschung in „Entwicklungsländern“ | | |
| | | | | |
| 3 | 18.4.1.7 | die Ziele, Aufgaben und Arbeitsweise von Ethikkommissionen zur Begutachtung von Forschung am Menschen erläutern.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Unabhängige Prüfung von Forschungsvorhaben, Schutz teilnehmender Personen | | |
| | | | | |
| 1 | 18.5 | Die Absolventin/der Absolvent können die Grundlagen von Ethik, Recht und Berufskunde in Gesundheitswesen und Public Health erläutern. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.5.1.1 | Grundzüge der historischen Entwicklung der Gesundheitsversorgung in Deutschland beschreiben.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.5.1.2 | die sozioökonomischen Determinanten der Gesundheit und die daraus resultierenden Ungleichheiten im Gesundheitszustand der Menschen sowie im Zugang zur zahnärztlichen Versorgung in Deutschland und global exemplarisch wiedergeben und beschreiben.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Sozialisation, Bildungsgrad, Arbeits- und Wohnverhältnisse (Lebensstandard), Einkommensverhältnisse | | |
| | | | | |
| 3 | 18.5.1.3 | unterschiedliche Ebenen der Allokation benennen und die Grundlagen der Allokationsentscheidungen auf den verschiedenen Ebenen erklären.  | | | | 2 | | | | | | | | | Makroebene, Mesoebene, Mikroebene | | |
| | | | | |
| 3 | 18.5.1.4 | die gerechtigkeitsethische Relevanz der Gesundheit und der Gesundheitsversorgung erklären sowie formale und materiale Kriterien für eine gerechte Gesundheitsversorgung benennen.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Interpersonale, intergenerationelle Gerechtigkeit und globale Gerechtigkeit; formale Kriterien: Konsensbeschluss, Mehrheitsbeschluss; materiale Kriterien: Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit, Gleichbehandlung | | |
| | | | | |
| 3 | 18.5.1.5 | unterschiedliche Strategien zum Umgang mit knappen Mitteln im Gesundheitswesen differenzieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Mittelerhöhung, Effizienzsteigerung (Rationalisierung), Leistungseinschränkung (Rationierung) | | |
| | | | | |
| 3 | 18.5.1.6 | die verschiedenen Formen der Rationierung benennen und ihre jeweiligen ethischen Implikationen erklären und bewerten.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Implizite versus eplizite, harte versus weiche, direkte versus indirekte Rationierung | | |
| | | | | |
| 3 | 18.5.1.7 | das Prinzip und die Zielsetzung von Priorisierung erklären und unterschiedliche formale und inhaltliche Kriterien von Priorisierungsmaßnahmen bewerten.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Notwendigkeit, Wirksamkeit und/oder Kosteneffizienz einer Leistung | | |
| | | | | |
| 3 | 18.5.1.8 | grundlegende Fragestellungen der Public-Health-Ethik benennen.  | | 1 | | 1 | | | | | | | | | soziale und gesundheitliche Ungleichheiten, Impfen und Impfzwang, Ausgestaltung von Gesundheitsinformationen, ethische Standards in der epidemiologischen Forschung | | |
| | | | | |
| 1 | 18.6 | Die Absolventin/der Absolvent kennen die normativen Standards einer patientengerechten Kommunikation und können diese praktizieren. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.6.1.1 | die Unterschiede zwischen den Begrifflichkeiten von Diagnose, Indikationsstellung und Prognose benennen und
den doppelten Charakter ärztlicher Aussagen als logischer Urteile und praktischer Handlungen (Sachebene) sowie ihre emotionale Wirkung auf Patientinnen/Patienten ethisch reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Ängste, Reflektion über die Zukunft, Extraktionsnotwendigkeit bei jüngeren Patienteninnen und Patienten, Verdacht auf maligne Tumore | | |
| | | | | |
| 3 | 18.6.1.2 | grundlegende Merkmale und Aufgaben der Kommunikation benennen und die besondere Herausforderung der Kommunikation zwischen Zahnärztinnen/Zahnärzten und Patientinnen/Patienten ethisch reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | „Kommunikationswerkzeug“ Mund als Gegenstand zahnärztlicher Behandlung | | |
| | | | | |
| 3 | 18.6.1.3 | die wesentlichen fachlich und ethisch relevanten Kommunikationsfehler und -fallen kritisch bewerten.  | | 2 | | 2 | | | | | | | | | "Schweigespirale", "Killerphrasen", Bagatellisierung | | |
| | | | | |
| 3 | 18.6.1.4 | die normativen Standards und die Orientierungshilfen für eine patientengerechte Kommunikation sachgerecht anwenden.  | | 2 | | 3b | | | | | | | | | geeignetes Gesprächssetting, bedarfs- und personenadaptierte Gesprächsgestaltung | | |
| | | | | |
| 1 | 18.7 | Die Absolventin/der Absolvent kennen grundlegende normative Aspekte von Gesundheit und Krankheit und können diese erläutern. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.7.1.1 | die konzeptionellen Herausforderungen und die ethische Dimension eines allgemeinen Gesundheits- und Krankheitsbegriffs erläutern.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Definitionsmacht der Medizin betreffend Gesundheit und Krankheit, Stigmatisierungsphänomene bei bestimmten Erkrankungen (Anoreie, Schizophrenie) | | |
| | | | | |
| 3 | 18.7.1.2 | den Unterschied zwischen medizinischen Krankheitsbegriffen und den subjektiven Krankheitsvorstellungen medizinischer Laien reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.7.1.3 | den Einfluss unterschiedlicher kultureller Voraussetzungen und sozialer Wertvorstellungen auf das Krankheits- und Gesundheitsverständnis reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Zeit- und Kontextabhängigkeit von Krankheitsbegriffen und Pathologisierungsphänomenen (Homosexualität, Transsexualität) | | |
| | | | | |
| 1 | 18.8 | Die Absolventin/der Absolvent kennen spezifische normative Herausforderungen des Zahnarztberufs und können diese erläutern und reflektieren. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.8.1.1 | relevante ethische und rechtliche Aspekte des Umgangs mit Zahnbehandlungsphobie in Abhängigkeit von Patientinnen/Patienten reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Vulnerabilität, Entscheidungs[un]fähigkeit, Respekt vor der Patientenautonomie versus Benefizienz-Prinzip, Zwangsmaßnahmen beim kindlichen Patienten, Sanierung in ITN | | |
| | | | | |
| 3 | 18.8.1.2 | grundlegende Kennzeichen und Formen der Wunscherfüllenden Zahnmedizin sowie des Therapiewunsches ohne zahnmedizinische und medizinische Indikationen ethisch reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Zahnkosmetik, Orale Piercings, Dental Wellness und Dental SPA | | |
| | | | | |
| 3 | 18.8.1.3 | die ethischen und (berufs)rechtlichen Implikationen der wunscherfüllenden Zahnmedizin kritisch reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | die Aushöhlung des zahnärztlichen Heilauftrags, Änderung des zahnärztlichen Selbst- und Fremdbildes (Imageverlust), Gefahr der Deprofessionalisierung | | |
| | | | | |
| 1 | 18.9 | Die Absolventin/der Absolvent weiß um die wesentlichen Sorgfaltspflichten, Fehlerquellen und Formen des Fehlverhaltens in zahnärztlicher Praxis und Wissenschaft und kann diese erläutern. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.9.1.1 | grundlegende Begrifflichkeiten differenzieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Good Clinical Practice (GCP), Erfolg, Misserfolg, Behandlungsfehler, Good Scientific Practice (GSP), Plagiat, Ehrenautorschaft, Whistle blowing | | |
| | | | | |
| 3 | 18.9.1.2 | grundlegende Fehlertypen, deren Kennzeichen und Implikationen ethisch reflektieren.  | | | | 2 | | | | | | | | | Diagnosefehler, Behandlungsfehler, Schnittstellenfehler, Medikationsfehler, Eingriffsverwechslungen, Übernahmeverschulden | | |
| | | | | |
| 3 | 18.9.1.3 | die Grundsätze und grundlegende Normen der Fehlerprävention und des Fehlermanagements ethisch reflektieren.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Fehlermanagementsystem „Jeder Zahn zählt“ | | |
| | | | | |
| 3 | 18.9.1.4 | die (berufs)rechtlichen Konsequenzen, die ggf. aus fehlerhaftem oder pflichtwidrigem Verhalten resultieren, beschreiben.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Haftungsschäden, Sanktionen | | |
| | | | | |
| 3 | 18.9.1.5 | die grundlegenden Regeln und Instanzen zur Sicherung wissenschaftlicher Praxis, die Formen und Implikationen wissenschaftlichen Fehlverhaltens und die rechtlichen Konsequenzen ethisch reflektieren.  | | | | 2 | | | | | | | | | DFG-Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, Ombudsmann, Kommission zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens | | |
| | | | | |
| 1 | 18.10 | Die Absolventin/der Absolvent kennen die Grundlagen der Forensischen Odontostomatologie und können diese einordnen. Sie können ...  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 18.10.1.1 | die Rolle von Zahnärztinnen/Zahnärzten, die juristischen Grundlagen und die Möglichkeiten ihrer Einbindung in Zivil- und Strafprozessen einordnen.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | (sachverständiger) Zeuge, Sachverständiger, Sozial- und (Arzt-) haftungsrecht, Schweigepflicht/Entbindung davon | | |
| | | | | |
| 3 | 18.10.1.2 | die rechtliche und ethische Bedeutung sowie die fachlichen Grundzüge der Identifizierung unbekannter Toter beschreiben.  | | 1 | | 2 | | | | | | | | | zahnärztliche Identifizierung | | |
| | | | | |
| 3 | 18.10.1.3 | Anzeichen häuslicher/familiärer Gewalt erkennen und gerichtsverwertbar dokumentieren sowie die gebotenen Handlungsoptionen rechtlich und ethisch einordnen.  | | 2 | | 3b | | | | | | | | | Bissspuren, Folgen von Gewalteinwirkung, Vernachlässigung und Misshandlung, Dokumentation, Einleitung weiterführender Maßnahmen | | |
| | | | | |
| 3 | 18.10.1.4 | die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Untersuchungsmethoden der Altersdiagnostik bei lebenden Menschen benennen.  | | 1 | | 1 | | | | | | | | | richterlicher Beschluss, körperliche Untersuchung und radiologische Verfahren | | |
| | | | | |

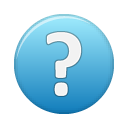 Hilfe
Hilfe
 Mit Klick auf die Lupe wird das entsprechende Lernziel vermerkt. Alle vermerkten Lernziele können über den Link "Gemerkte Lernziele -> Anzeigen" im Kopf der Tabelle angezeigt und verglichen werden.
Mit Klick auf die Lupe wird das entsprechende Lernziel vermerkt. Alle vermerkten Lernziele können über den Link "Gemerkte Lernziele -> Anzeigen" im Kopf der Tabelle angezeigt und verglichen werden.